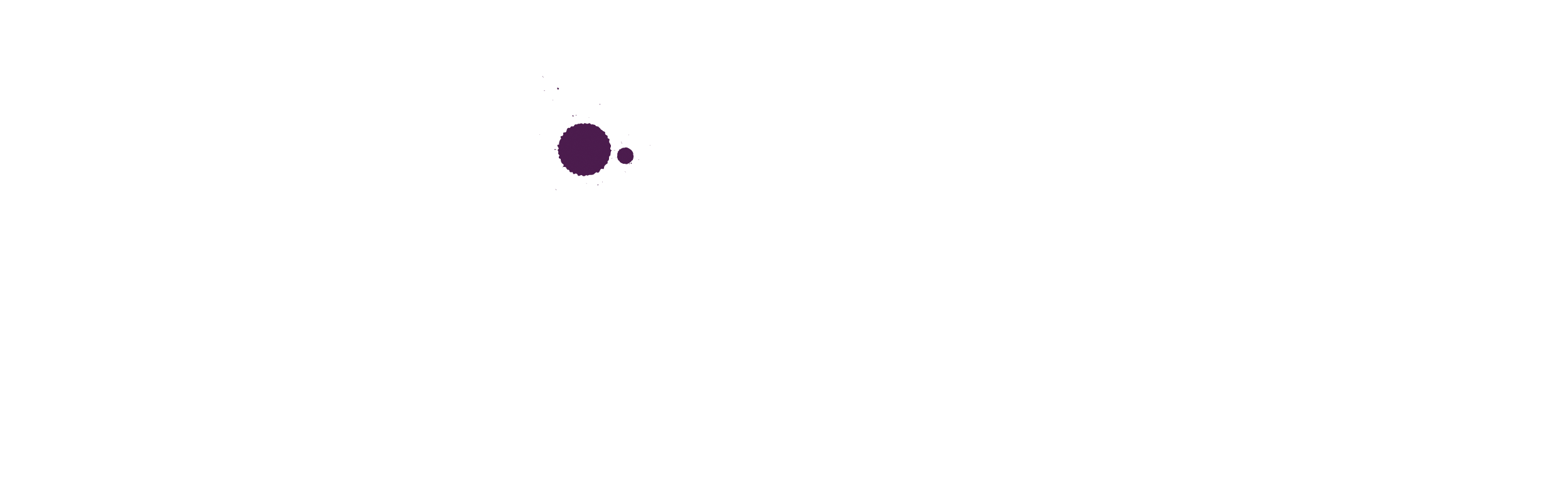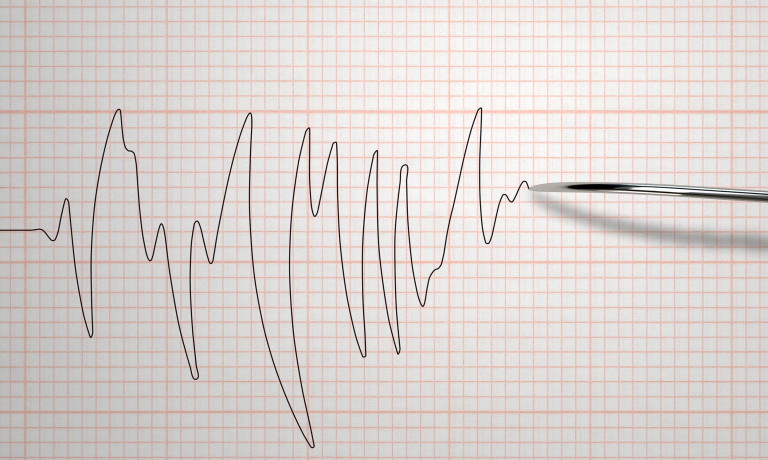Bei der Betrachtung der aktuellen Weltlage kann sich schon ein flaues Gefühl im Magen breit machen – da nützt auch der Advent, die Zeit der freudigen Erwartung, wenig. Humanismus scheint momentan nicht mehr en vogue zu sein. Der Umgangston ist ruppig, nicht nur in den Medien und in der Politik, oft auch im Alltag. Lügen ist salonfähig – und wenn nicht gerade aktiv gelogen wird, werden die nicht zur Argumentation passenden Fakten halt weggelassen.

Das feuchte Klima, wie es auch auf den britischen Inseln vorherrscht, hat den Nebeneffekt, dass ich binnen weniger Sekunden aussehe wie Diana Ross. Eine sehr schlecht gestylte Version von Diana Ross. Statt hochtoupierter Lockenpracht sehen meine Haare eher so aus, als hätte ich in die – im Badezimmer des Hotels nicht vorhandene – Steckdose gegriffen.

Prokrastination, das gescheite Wort für «Ich mache es später», begleitet mich wie ein treuer Freund. Besonders, wenn es um Schreibarbeiten geht. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe es zu schreiben. Deswegen ist meine Langzeitbeziehung zur Prokrastination nicht unbedingt förderlich. So schwierig kann es doch nicht sein, ein paar Sätze zu Papier zu kriegen?

Frühling liegt in der Luft. Auch wenn es dafür zu früh ist und die Wetterapp noch mit Minustemperaturen droht. Meine Nase zeigt an, dass bereits einige Pollen rumfliegen und ein Blick in die Büsche und Sträucher bestätigt: Spriessende Knospen, erste zartgrüne Blättchen. Die Natur kann es offensichtlich kaum erwarten. Ich beschliesse, es der Natur gleichzutun und aus dem Winterschlaf aufzuwachen.

Auch wenn es harzt, ich freue mich auf den Moment, in dem ich mich fallenlassen und seitlich in die ineinander verschwimmenden Tage zwischen Weihnachten und Neujahr kippen kann. Erst mal liegenbleiben und 2023 noch etwas 2023 seinlassen, während man noch nicht vollständig an das anstehende, neue Jahr denken muss.

Der Tannenbaum in der Wohnzimmerecke verliert langsam, aber sicher seine Nadeln und der Weihnachtsschmuck glitzert einem grell entgegen. Das eigene Spiegelbild in den Christbaumkugeln ruft nicht mehr die Erinnerung an fröhliche Abende im Kreise der Liebsten hervor, sondern mahnt, dass es an der Zeit wäre, Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen den fett- und kalorienreichen Festtagsspeisen vorzuziehen.

War es das jetzt mit dieser Pandemie? Es wäre uns zu gönnen. Dennoch beschleicht mich die leise Ahnung, dass uns die aktuelle «Vogel-Strauss-Taktik» demnächst wieder einholen wird. Ich fürchte mich weniger vor einer neuen Virusvariante, auch wenn der Versuch, in der aktuellen Lage gesund zu bleiben, anstrengender als auch schon ist.

Kennen Sie das Lied «D’Nase» von Mani Matter? Die tragisch-komische Geschichte eines Mannes mit zu langer Nase, der nach einer Kürzung ebendieser, sein Leben beim Überqueren der Strasse lässt, da ihm seine neue, kurze Nase nicht mehr die Richtung weist? Meine Nase beschäftigte mich die letzten Wochen über alle Massen.

Ich bin übersättigt von den sich stets wieder aufs neue übertrumpfenden Bad News und die immer wieder ob neuen Banalitäten aufschäumenden Empörungswellen bringen mich zur Verzweiflung. Ich mag an meinem Feierabend nicht mehr über richtigen oder falschen Feminismus nachdenken, meine Gedanken um «cultural appropriation» kreisen lassen oder durch die neusten Schreckensbilder aus der Ukraine scrollen.

Woher also das plötzliche Bedürfnis, all meine Zelte in meiner Heimat abzubrechen und auf eine Insel in den Niederlanden zu fliehen? Es beschleicht mich das Gefühl, dass die Magie dieser Ferien vielleicht nicht ganz so stark mit den wunderschönen Sonnenuntergängen, dem Wind über den Dünen und den malerischen Polderlandschaften Nordhollands verbunden ist, als ich mir eingestehe.

Während «Brüllaffen» früher noch von der Gesellschaft in ihre Schranken gewiesen wurden, überlässt man ihnen heute freudig-erregt jede noch so grosse Bühne. Jeder ihrer gedanklichen Scheisshaufen wird im Scheinwerferlicht als relevante Meinung präsentiert. Dabei müssen sich die «Brüllaffen» nicht für ihren verbalen Dünnpfiff rechtfertigen oder dessen Rechtmässigkeit beweisen. Eine kernige Aussage reicht.

Es ist wieder Wochenende. Spätestens nach Drucklegung der Sonntagspresse ist es an der Zeit für eine neue Vorstellung im glamourösen wöchentlichen Forderungs-Zirkus. Die Kakophonie, die dieses Schauspiel wöchentlich zutage bringt, ist an Absurdität inzwischen kaum mehr zu übertreffen. Ich habe mich entschieden, jetzt mal selbst eine Nummer zu diesem wöchentlichen Affentheater beizusteuern.

Ist ein Toter, der «mit» Cornona-Virus gestorben ist, beispielsweise weil er unter diversen Vorerkrankungen litt und sich jetzt dummerweise noch angesteckt hat, weniger wert, als eine Person, die, ansonsten kerngesund, «am» Virus starb? Wo liegt der Unterschied, ob jemand «an» oder «mit» etwas gestorben ist? Wer zieht diese unsichtbare Grenze? Und was macht es schlussendlich für einen Unterschied?

In Anbetracht der globalen Lage und mit einem Blick zurück ins Jahr 2014, als die Des-Alpes-Frage die Bevölkerung spaltete, wie kaum eine andere (von der Gemeindefusion 2009 abgesehen), ist jetzt der richtige Moment, um erneut zu prüfen, ob das Pferd, dass man mit dem Versuch eines Hotelprojektes im Zentrum von Interlaken gesattelt hat, nur vorübergehend sediert ist oder doch tot am Strassenrand liegt.

Eine weltweite Pandemie gekoppelt mit der heutigen Mobilität und den veränderten, schnellen, unerschöpflichen Informationsflüssen, Internet sei Dank, sowie all den technischen Alltagshelfern und Apps für jedes Problem und Problemchen führt bei vielen zu einer kompletten Überhitzung der Hirnwindungen.

Gleichzeitig ist mir durch die Installation der SwissCovid-App wieder schmerzlich bewusst geworden, wie ketzerisch mein Umgang mit meiner Privatsphäre und dem Verfechten des Datenschutzes ist. Ich sende tagtäglich eine gewaltige Menge an Daten an den Hacker Way 1 in Menlo Park (Facebook), den Infinite Loop 1 in Cupertino (Apple) oder den Amphitheatre Parkway 1600 in Mountain View (Google) ohne mir darüber Gedanken zu machen.
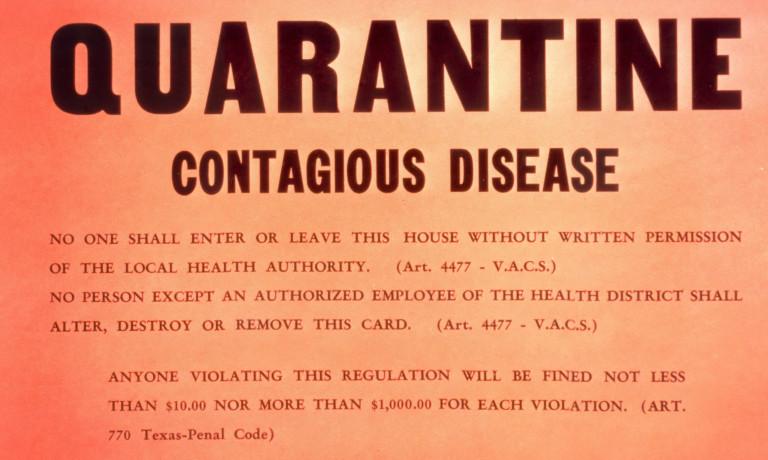
Waren Sie schon im Gartencenter? Bald soll in unserem Corona-gebeutelten, an Sozialkontakten armen Alltag wieder Normalität einkehren. Oder «the new normal», wie das einige Konzerne in ihren Strategien für die schrittweise Wiederansiedlung ihrer Mitarbeitenden in den verwaisten Betriebsgebäuden modern nennen. Wir alle erleben gerade, wie Geschichte geschrieben wird. Während wir als Jugendliche im Präsenzunterricht noch die Folgen der Pest behandelt haben, werden sich die Generationen nach uns wohl mit dem Coronavirus beschäftigen.

Ich verfalle nicht in Panik, aber: Exponentielles Wachstum, wie es auch bei der Verbreitung von Viren vorkommt, ist ein hinterlistiges, mathematisches Modell, das unser Vorstellungsvermögen nach kurzer Zeit an seine Grenzen bringt. Bei mir steht nicht die Angst, dass ich oder mein nahes Umfeld am Corona-Virus erkranken, im Vordergrund. Auch wenn dieses Szenario, bei der Betrachtung der aktuellen Zahlen und mathematischen Modelle, realistisch wird.

Was mich aber zur Weissglut bringt, ist die Gleichgültigkeit, mit der wir in unserer Sprache mit den Geschlechterformen umspringen. Keine Sorge, ich halte an dieser Stelle keinen leidenschaftlichen Vortrag über die Binnen-Schreibweise, das Gendersternchen finde ich zum im Dreieck springen und fantasievolle Lösungen wie die X-Form können mir gestohlen bleiben.

Während vor nicht allzu vielen Jahren die Vorfreude auf Weihnachten, Silvester und – als Interlaknerin – auf den 2. Jänner noch alle anderen Gefühlslagen übertünchen mochte, stehe ich heute dieser Zeit mit gemischteren Gefühlen gegenüber. Keine Sorge, eine Weihnachtsdepression ereilt mich deswegen nicht… Ich werde jedoch öfter nostalgisch.

Ich habe etwas im Internet bestellt. Nicht dass das komplett neu für mich wäre, aber ich bin zum ersten Mal so richtig dem Zauber einer Instagram-Werbeanzeige erlegen. Abends, auf der Couch, als die Lasagne im Backofen vor sich hin brutzelte, habe ich den unübersehbaren «Order now» Button geklickt. Zwei Tage später war das Päckchen da: In ihm ein kleiner, achteckiger Würfel, Aufkleber mit verschiedenen Symbolen und ein Stift.

Ich bin verkatert. So richtig. Während andere sich vielleicht mit Kopfschmerzen und Übelkeit der vergangenen Weihnachtsfeierlichkeiten herumschlagen, plagt mich ein veritabler Online-Kater. 4 Stunden 21 Minuten Bildschirmzeit. Pro Tag. Das ist die traurige Bilanz der letzten Feier- und Ferientage, die mir mein Handy liefert. Wie konnte es bloss soweit kommen?

Ich mag den Winter nicht besonders. Könnte ich drei Monate ersatzlos streichen, es wären November, Januar und Februar. Sollten Sie in einem dieser drei Monate Geburtstag feiern: Bitte entschuldigen Sie. Ich finde klirrende Kälte, tonnenweise Schnee und den vor allem in unseren Breitengraden daraus resultierenden «Pflotsch» nicht sexy. Sie merken es: Winter? Nicht so mein Ding.

Es ist wie beim Seilziehen, nur komplexer: Die beiden Seiten stehen extrem weit auseinander und im minutentakt wechseln mehrere Wettkämpfer die Seite. Zum einen wird moniert, dass wir beim Datenschutzgesetz zu langsam vorwärts kommen, aber im gleichen Atemzug verlangt man lautstark, dass E-Voting eingeführt wird.

Dieses Chili ist mit Weihnachten verbunden, weil wir seit drei Jahren eine neue «Tradition» haben: Am 24.12. gibt es Chili con Carne. 2015 und 2016 gab es das sogar öffentlich im Buddy's Pub als Begleiter zu einem lokalen Bier. Mit (damals neuen) Freunden, einem Bier und einer essbaren Kleinigkeit in das Fest der Liebe einzusteigen, ist eine schöne Sache.

Seit Tagen zucken mir die Finger. Jedes Mal, wenn ich mich auf Facebook anmelde, die gleiche Leier: «Aktualisieren. Es funktioniert!! Ich habe einen ganz neuen Newsfeed…» Ich will mir die Qualen ersparen und verzichte darauf, hier den ganzen (btw in ganz grausigem Deutsch verfassten) Quatsch niederzuschreiben. Ihr ahnt es: BULLSHIT!

Als Kind war für mich der Keller ein magischer Ort; eine Wunderwelt, die auf knapp drei Quadratmetern so manches Geheimnis versteckt hält. Der Raum dient als Zwischen- und Endlager für alle möglichen Dinge. An der Stirnwand glitzern die Weinflaschen im fahlen Lichtschein. Rotwein? Weisswein? Was sich in den zahlreichen Flaschen versteckt, ist auf den ersten Blick nicht auszumachen. Neben dem Eingang steht ein hoher Einbauschrank: Für Klein-Irene das Paradies. Er ist von unten bis oben mit Gläschen, Flaschen und Töpfen gefüllt. Grosis Meertrübeligonfi, Holunderblütensirup, eingelegtes Gemüse aus dem eigenen Schrebergarten…

Auf meinem Streifzug ist ein unauffälliges Gläschen Marmelade in meiner Einkaufstüte gelandet. Ich weiss nur noch, dass mich die Kombination «Aprikose-Birne-Lavendel» irgendwie faszinierte. Und probieren schadet ja nie. Wieder zu Hause habe ich die Marmelade erst mal für längere Zeit vergessen. Bis ich eines Sonntagmorgens wieder an das kleine Gläschen dachte und es endlich seinen Platz auf dem Frühstückstisch fand. Nach dem ersten Bissen vom «Gonfi-Brot» wurde mir klar, dass die Tage meiner bisherigen Konfitüren-Favoriten gezählt waren.

Meine Arbeit bringt es mit sich, dass ich einen grossen Teil meiner Zeit vor irgendwelchen Bildschirmen verbringe. Texte schreiben sich am Computer schneller und einfacher, das Internet ist ein grosser Informationspool und die sozialen Medien wichtige Kommunikationskanäle. So sitze ich also am Bürotisch vor dem PC, auf dem Balkon am Laptop und zwischendurch recherchiere ich auf dem Sofa ein bisschen mit dem iPad im World Wide Web herum. Zum Zeitvertreib (sie dürfen das ruhig Prokrastination nennen), guck’ ich immer mal wieder auf mein Smartphone, in der Hoffnung etwas Spannendes aufzuschnappen. Ich will ganz ehrlich mit ihnen sein: Ich bin süchtig!

Kakaobohnen, Tonkabohnen und Vanillebohnen – hört sich doch gar nicht so schlecht an, oder? Wenn das Ganze allerdings in Bierform dargereicht wird: «HUSSDRTÖIFEL!!» Aber Bier kann man (ich) nicht einfach so wegschmeissen. Was also tun? Die Zutaten klingen für mich eher nach Zuckerbäckerei, warum also nicht einen Bierkuchen backen?

Gerade könnte ich wie Rumpelstilzchen schreiend durch die Gegend rennen. «Boden öffne Dich und verschlucke mich!» Oder all die anderen Trottel. Irgendwo (ziemlich sicher auf Twitter) hab ich mal folgendes gelesen:« Ich mag die Menschen – wirklich - wenn nur diese verdammten Individuen nicht wären!» Genau so fühle ich mich im Moment. Ich schaue mich im Spiegel an und überprüfe was mir fehlt. Arme, Beine – alles da. Sogar den Kopf trage ich auf dem Hals und nicht unter dem Arm, wie man manchmal meinen könnte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich in diesem Kopf auch ein funktionierender Denkapparat befindet. Manchmal. Und dieser Denkapparat läuft gerade ziemlich heiss.